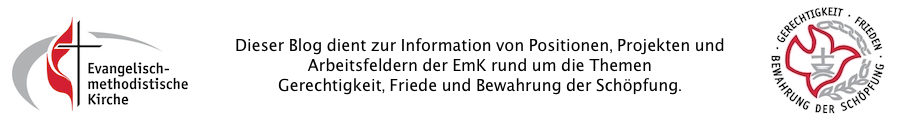Am 12. Dezember haben fast 200 Länder in Paris das erste umfassende Weltklimaabkommen der Geschichte unterschrieben. Darin stehen einige sehr gute Ziele, z.B. wird 1.5°C als wünschenswerte Grenze der Klimaerwärmung erwähnt (alles darüber führt u.a. zum Untergehen vieler Inselstaaten), es wurde vereinbart, dass alle fünf Jahre die nationalen Klimaziele aller Staaten überprüft werden (das soll sicherstellen, dass diese immer ambitionierter werden), und obwohl das Wort „Dekarbonisierung“ so nicht im Vertragstext steht, wird darin deutlich, dass spätestens nach 2050 fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Gas kaum noch verwendet werden sollen – eine wichtige Voraussetzung für das Erreichen der 1.5°C Grenze.
Der Klimavertrag hat aber einen großen Haken: Es wurden kaum Wege vereinbart, wie die genannten Ziele erreicht werden können. Der britische Umweltaktivist George Monbiots fasst es so zusammen: „Der Vertrag ist im Vergleich zu dem, was hätte sein können, ein Wunder. Im Vergleich aber zu dem, was hätte sein müssen, ist er ein Desaster.“ Mit dem Vertrag allein wird nicht automatisch ein Zustand von Gerechtigkeit hergestellt, geschweige denn der Klimawandel gestoppt. Es liegt jetzt an der Zivilgesellschaft, die Regierungen der Welt immer wieder an das zu erinnern, wozu sie sich verpflichtet haben.
Konkret können wir als Kirche nach Wegen suchen, wie wir eine Dekarbonisierung bis spätestens 2050 unterstützen können. Eine Methode wäre das Abziehen von Investitionen in fossile Energieträger und das investieren in regenerative Energien. Das sogenannte Divestment ist beides: Ein Signal, dass die Förderung von fossiler Energie unverantwortlich ist und ein Mittel dazu, dass Kohle, Öl und Gas im Boden bleibt und eine Begrenzung auf 1.5°C möglich macht.
Es wird bei den Klimaverhandlungen aber auch deutlich, dass trotz großer Anstrengungen ein „weiter-so“ der wachstumsgetriebenen Gesellschaft nicht möglich ist. Die industrialisierten Länder haben ihr Treibhausgas-Budget bei weitem ausgereizt. Eine faire Verteilung ist nur hinzubekommen, wenn wir unser Konsumverhalten und unsere Lebensweise ändern. Die Kirche kann einen Beitrag leisten, indem sie den Dialog um eine „Ethik des Genug“ vorantreibt: Wie schaffen wir es, dass alle Menschen ein würdiges Leben führen können, ohne die Ressourcen zukünftiger Generationen zu verbrauchen?
Ein Grundelement der Methodistischen Kirche ist die Konnexio, die weltweite Verbundenheit der Methodisten: Wer dazu gehört, gehört überall dazu. Damit sind manche Mitglieder unserer Kirche Opfer des Klimawandels, während andere zum Klimawandel beitragen. Ein Spannungsverhältnis, das zum Aktivwerden motiviert.
Hier gibt es unterschiedliche Meinungen zum Klimavertrag:
- Von Brot für die Welt als Text und als Video
- Von Oxfam Deutschland
- Vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie
Text: Daniel Obergfell, Bild: Flickr